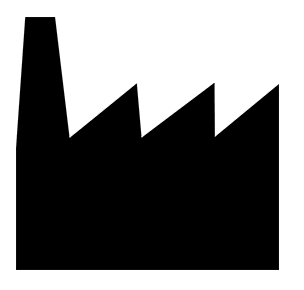Beim Versuch, ihr chronisches Kranksein zu akzeptieren, fand die Autorin heraus, dass sie ihre Vorstellungen von politischem Tätigsein entlernen und stattdessen eine radikale Selbstsorge mit politischer Sprengkraft entwerfen möchte.
Körperliche Einschränkungen zu akzeptieren, ist ein langer Prozess. Bei chronischen Krankheiten wird er vielleicht nie vollständig abgeschlossen sein. Denn auch wenn die Diagnosen in die eigene Identität eingebettet und der Alltag so zugänglich wie möglich eingerichtet wird, sind da noch die Symptome: Sie schmerzen, lassen nicht schlafen, machen müde und das Essen schwierig.
Ihr Nicht-Vorhandensein ist auf der einen Seite einfach vorzustellen – vor allem wenn es einmal eine symptomfreie Zeit gab, denn die Absenz von etwas Störendem wird als Wunsch umso stärker, je mehr es uns belästigt. Auf der anderen Seite ist ein Leben ohne Symptome für viele von uns chronisch Kranken so weit weg, dass davon nur eine neblige Ahnung übrig bleibt, weil wir die Symptome schon so lange haben – sie sind ja schliesslich chronisch.
Chronisch heisst, dass die Symptome lang andauern, irgendwo zwischen einem Monat und für immer. In diesem Text möchte ich meine Erfahrungen und Gedanken über den Krankheits-Akzeptanz-Prozess mitteilen. Bei mir ist dieser Prozess vor allem im Bezug zu meinem politischen Tätigsein herausfordernd. Ich möchte über diese Schwierigkeiten berichten, weil ich glaube, dass es vielen ähnlich geht wie mir.
Ich glaube, dass gesellschaftliche Veränderungen in Richtung eines gerechteren und freieren Zusammenlebens dringend nötig sind und dass diese Veränderungen nicht einfach so passieren, sondern dass sie von uns gemacht und erkämpft werden müssen. Statistisch gesehen sind einige von uns, wahrscheinlich sogar mehr als wir denken, chronisch krank oder werden es einmal sein. Weiter glaube ich, dass es wichtige Verflechtungen von Kranksein, Kapitalismus und den gängigen Vorstellungen von Politisieren in der radikalen Linken gibt, deren Betrachtung unser Denken und Handeln reflektierter und befreiter machen könnte.
Ein intellektueller Kampf gegen das «kranke System»?
Lange dachte ich irgendwie, dass das Akzeptieren meiner chronischen Krankheiten intellektuell zu bewältigen sei. Und dass eine intelligente Feministin wie ich dabei wahrscheinlich nicht allzu grosse Probleme haben würde. Ich dachte, dass ich diesen Prozess schnell abschliessen könnte, indem ich mir die richtigen Gedanken machen und daraus die richtigen Handlungen ableiten würde, um dann weiterzumachen wie bisher.
Ich lag falsch. Nachdenken, Lesen und Diskutieren helfen zwar dabei zu erkennen, dass ein grosser Teil unseres Leistungsdenkens kapitalistische Selbstdisziplinierung ist und dass die Vorstellung von «normalen Körpern» alles andere als normal ist. Aber die ganzen Gefühle von Enttäuschung und Scham darüber, zu wenig machen zu können, sitzen tiefer, als ich angenommen hatte.
In Selbsthilfebüchern las ich immer von Menschen, die damit haderten, ihre Familie im Stich zu lassen, weil sie es nicht schafften, am Sonntag Brettspiele zu spielen oder ihren Kindern selbstgefüllte Znüniböxli in die Schule mitzugeben. Oder von Leuten, die von einer tiefen Trauer erfasst wurden, als ihnen dämmerte, dass der vor Jahren gefasse Karriereplan aufgegeben werden musste oder sie vielleicht überhaupt nicht mehr arbeiten konnten.
Oder ich las von Bitterkeit, weil weder Mountainbiken noch Interrailen funktioniert, wenn alles wehtut. Ich dachte dann immer: Das betrifft mich nicht. Ich will keine Kinder, Interrail habe ich gemacht, Sport nie gemocht und Lohnarbeit ist doch eh nur kapitalistische Notwendigkeit und hoffentlich bald abgeschafft.
Ich dachte, diese Bedürfnisse und die daraus resultierenden schwierigen Gefühle entstünden, weil wir in einem kapitalistischen, sexistischen, und grundsätzlich falschen System leben. Ein System, das Unproduktive und Kranke hasst. Ein System, das wir kollektiv bekämpfen und durch unsere gerechteren und freieren Alternativen ersetzen sollten.
Wenn das leistungserzwingende Ausbeutungssystem weg ist, hadern wir auch nicht mehr so mit unserem Kränkeln, dachte ich. Deshalb würde es mir sicher nicht sehr schwerfallen, meine Krankheiten zu akzeptieren: Weil ich ja schliesslich weiss, dass ein Grossteil meiner Probleme nicht von meinem Körper ausgeht, sondern von der Gesellschaft, die nicht weiss, wie sie mit Kranken umgehen soll und die den Wert von Menschen an ihrer monetär verwertbaren Leistung misst.
Ableistische Gedanken tief in mir
Ich stellte mir also vor, wie ich nach einigen Jahren, mittendrin in diesem Prozess der Abarbeitung am «kranken System», aufwachen würde und meinen eigenen Krankheitszustand akzeptieren könnte. Ich wäre krank, aber am Kämpfen: Ich hielt am Glauben fest, dass sich Politik und Kranksein schnell auf eine heilsame Art und Weise einpendeln würden. In den ersten Jahren meines Krankseins glaubte ich im Geheimen sogar daran, dass ich vielleicht irgendwie – wundersam – in meinen Idealen aufgehen könnte und dann durch mein Tätigsein so erfüllt wäre, dass mein Körper wieder funktionieren würde. Was für ein christlicher und ableistischer Gedanke!
Er wurde von der Befürchtung genährt, dass vielleicht, vielleicht, vielleicht doch diejenigen medizinischen Autoritäten recht hatten, die andeuteten, dass meine Schmerzen aus meinem unzufriedenen, «hysterischen» Kopf kamen. Wie konnte ich sicher sein, dass sie nicht recht hatten? Vielleicht führte ich einfach mein Leben falsch, nicht in Übereinstimmung mit meinem Inneren, nicht in Einstimmung mit meinen Idealen – vielleicht macht mich das krank? Diese Angst kam von tief innen, dort wo die ganzen Vorstellungen über Krankheiten als Bestrafung des falschen Lebens sitzen, von denen ich nicht wusste, dass sie sich bereits vor langer Zeit in mich eingenistet hatten. Für meine Identität war ein engagiertes, ausserparlamentarisches Politikverständnis schon lange wichtig: Ein bisschen «Get off the internet, I’ll meet u in the street», ein bisschen «Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es», ein wenig «Alles andere ist Quark».
So gesehen muss ich aber irgendwo anwesend sein und etwas tun, um politisch zu handeln. Das ist nicht immer einfach, wenn ich manchmal krankheitsbedingt die Wohnung oder das Bett nicht verlassen kann.
Mit wehenden Haaren auf Barrikaden stehend
Mein abstrakt geglaubter Krankheits-Akzeptanz-Prozess ist an die Anforderungen meines politischen Tätigseins gefesselt: Krank konnte ich nicht mehr zuverlässig an Sitzungen gehen und Termine abmachen und hatte x-fach Angst vor Repression. Was wäre, wenn ich verhaftet würde, ohne meine Medis dabeizuhaben oder eingekesselt einen Crash hätte?
Ich fühlte mich unverstanden und nicht mitgedacht, wenn vorausgesetzt wurde, dass an kalten, unbequemen oder mit Reizen überfluteten Orten marschiert, gestanden, geschrien, geplant, gesessen wurde. Denn so sieht politischer Kampf doch klassisch aus: motivierte, starke, standfeste Körper mit Wind in den Haaren auf Barrikaden stehend, bereit sich in Gefahr zu stürzen. Dazu passt es schlecht, dass meine chronischen Krankheiten dazu führen, dass mein Hirn normale Mitteilungen meiner Körperteile als Schmerzen interpretiert und so, die Gefahr in mir selbst verortend, dauernd in Alarmbereitschaft ist.
Ich bin gerade nicht standfest und auch nicht motiviert. Motivation braucht einen Überschuss an Energie, Standhaftigkeit braucht ein funktionierendes orthostatisches System. Und wenn ich die Bedeutung von «chronisch» tatsächlich annehmen will, bedeutet das auch, mir einzugestehen, dass es möglich ist, dass ich weder morgen noch in einigen Jahren standfest oder motiviert sein könnte.
Der saure Kern
Dass ich nicht so sein kann, wie ich es mir vorstelle, und das, bevor ich es überhaupt richtig ausprobieren konnte, weil ich jung krank wurde, fühlt sich wie das Schlucken eines mit Säure getränkten Avocadokerns an. So, als wäre mir etwas lange Versprochenes nicht nur entrissen, sondern seitdem auch fast täglich vorgeführt worden. Beispielsweise dann, wenn ich in politischen Räumen mitbekomme, dass die Handlungsfähigkeit von anderen gewisse Tätigkeiten umfasst, die mir nicht mehr zugänglich sind. Oder dann, wenn ich merke, dass gewisse Leute in diesen Räumen sich nicht bewusst sind, dass diese Handlungen nicht allen offenstehen, oder aber, wenn sie darum wissen und trotzdem eine «verdammt nochmals, warum macht ausser mir niemand was, die Welt geht schliesslich vor die Hunde»-Attitude pflegen.
Schlussendlich spielt es keine Rolle, ob um Mountainbiken oder linkes Politzeugs getrauert wird. Beides geht tief und erinnert doch irgendwie schnell an den eigenen Tod und daran, dass wir weniger im Griff haben, als wir gerne glauben wollen. Damit ich jetzt und zukünftig nicht nur enttäuscht rumliege, könnte ich meine Situation akzeptieren und die damit einhergehenden neuen Handlungsspielräume entdecken. Die Leute aus den Selbsthilfebüchern und ich könnten lernen, dass wir Gewisses aufgeben, anderes um-deuten können. Bezogen auf anarcha-feministische Politik habe ich eigentlich Glück gehabt: Sie ist vielseitig. Und viele Vordenker*innen und Mitstreiter*innen haben schliesslich darauf aufmerksam gemacht, dass das Auf-Barrikaden-Stehen und das Immer-Wieder-Verhaftet-Werden – wie unausweichlich dies auch sein kann – als Inbegriff von revolutionärer Politik zu kurz gedacht ist.
Die Dekonstruktion meiner Politikvorstellung
Ich hatte vergessen, meine eigene Politikvorstellung zu dekonstruieren. Ich hatte vergessen, meine abled bodied, mit Männlichkeit assoziierten Ideale zu entlernen. Ich hatte vergessen zu fragen, wer denn bei dieser standfesten Politikvorstellung nicht dabei sein kann, wer wohl stattdessen Care-Arbeit leistet und warum diese auch hier so viel weniger Achtung findet. Ich hatte vergessen, was Feminist*innen schon lange sagen; dass das Private politisch ist und dass diese Trennung eigentlich faul ist. Sowie die ganzen anderen nervigen Binaritäten, durch deren Überwindung es uns allen besser gehen könnte. Ich hatte vergessen, dass meine strenge Einteilung in politisches Voranschreiten und unpolitisches Liegen zu einfach gedacht ist. Ich hatte vergessen, dass wirklich revolutionäre und emanzipierende Politik die Fähigkeiten und Bedürfnisse unserer Vielheit umschliessen muss.
Ich wollte mir diese Gedanken als beruhigenden Balsam über meine Angst streichen, über die Angst, selbst zu wenig für eine bessere Welt zu tun, zu wenig teilzuhaben und sichtbar zu sein als eine von denen, die es versuchen. Denn schlussendlich war es auch genau diese Angst, die mich neben den sonstigen Symptomen ins Bett drückte und blockierte. Sie ist es, die mich davon abhält, Formen des politischen Handelns zu finden, die mir und meinen kranken Freundinnen offenstehen.
Ich möchte also diejenigen Elemente meines Politikverständnis entlernen, die mir nicht guttun und stattdessen gemeinsam mit anderen Kranken ein Politikverständnis entwerfen, das unsere Handlungsfähigkeit stärkt, statt uns durch Schuldgefühle zu schwächen. Ein Politikverständnis, in dem wir Sorge um uns tragen können, ohne ins individualistische Self-Care Business abzurutschen, in dem das Erwerben einer Gesichtsmaske mit persönlicher Befreiung gleichgesetzt wird. Ein Politikverständnis, das Sprengkraft hat und uns ermutigt, dass Veränderungen möglich und notwendig sind.
Doch was kommt, wenn dieser ständige Entlernprozess glückt und Platz für eine umfassendere Politikvorstellung gemacht wird? Wie ist es emotional einzuordnen, wenn wir wie Johanna Hedva mit einer solidarisch ausgestreckten Faust im Bett liegen, während unten auf der Strasse die Demo vorbeizieht? Und wie wird dies alles eingeordnet im Wissen darum, dass wir – die, die eine gerechtere und freiere Welt für alle wollen – nicht auf standfestes und zuverlässiges Kämpfen und Organisieren verzichten können, wir auf Strassen auftauchen und unsere Räume verteidigen müssen und es mit grosser Wahrscheinlichkeit umso wilder wird, je grösser die von uns verkörperte Gefahr für das schlechte System wird? Wie kann das alles vermittelt und in ein krankheitsakzeptierendes, politisches Selbst eingebunden werden? Wie kann ich meine Rolle als chronisch und politische Kranke in diesem Ganzen ausmachen?
Ich suche nach Arten, wie ich diese neuen Gedanken in mich einbetten kann
Und ich suche Menschen, die sich in der gleichen Situation befinden. Ich habe den Verdacht: Von uns gibt es viele. Im Gespräch mit Freundinnen bemerken wir immer wieder, dass es helfen könnte, sich nicht als einzelnes Subjekt, sondern als Teil einer vielseitigen und grossen Bewegung zu fühlen. Eine Bewegung, in der nach Fähigkeiten und Bedürfnissen das gemacht wird, was geht. So könnte der Spruch «Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt?» für chronisch krankes Politisieren lauten: «Nicht ich, aber wir. Solidarische Grüsse aus dem Bett» und «Wann, wenn nicht dann, wenn es mir wieder ein bisschen besser geht».
Die Kunst liegt dabei aber sicher darin, zu vertrauen, dass man den Moment bemerkt, in dem es dann doch darum geht, mit dem kranken Körper dem schlechten System die letzten Stösse zu versetzen oder ihn schützend vor unsere Strukturen zu stellen. Ein weiterer Verdacht: Es wäre ebenfalls hilfreich, szenig krasses Gehabe und mackerisches Abwerten von (Self-)Carearbeit sichtbar zu machen, zu kritisieren und abzuschaffen. Auch in uns selbst, damit wir Ableismus und seine kapitalistischen Leistungsforderungen gemeinsam immer wieder aus uns herauslösen können.
Wichtig ist sicher auch, Verbindungen zwischen dem eigenen Gesundheitszustand und Unterdrückungsmechanismen festzustellen: Kapitalismus, Rassismus, Sexismus, Klassismus, Hetero- und Cis-Normativität, Ableismus, und andere Diskriminierungs- und Unterdrückungsverhältnisse beeinflussen das Auftreten von Traumatisierungen und Erkrankungen, erschweren den Zugang zu benötigten Ressourcen und beeinflussen die Sterblichkeitsrate von verschiedenen Erkrankungen.
In unserem neoliberalen System werden gewisse Erfahrungen, Schwierigkeiten und menschliche Zustände zunehmend als medizinische Probleme definiert, für die Medikamente gekauft werden sollen. Gleichzeitig kämpfen Menschen für die dringend benötigte Anerkennung gewisser Diagnosen, die heute noch zu wenig gesellschaftliche Legitimität haben, um Betroffenen den Zugang zu entsprechenden Hilfeleistungen zu ermöglichen.
Kranksein ist ein kompliziertes Terrain. Was sich aus diesen ganzen Überlegungen und Gefühlen herauskristallisiert, ist aber der Entwurf der Idee einer radikalen Selbstsorge. Manchmal besteht sie vielleicht darin, zu Hause zu bleiben und lieb zu sich zu sein, obwohl «die, die es versuchen» jetzt alle an irgendeinem Politanlass sind und mich meine Polit-FOMO panisch macht. Manchmal besteht sie vielleicht darin, gegen Arzt*innen und andere Gatekeeper*innen aufzustehen und uns gegenseitig im Kampf um benötigte (medizinische) Ressourcen zu unterstützen. Manchmal darin, Ableismus in der radikalen Linken oder in feministischen Räumen anzusprechen. Manchmal aus dem Ausmachen des feinen Grades zwischen radikalem Auf-Sich-Acht-Geben und der konsumistischen Self-Care Version davon, bei der es schlussendlich darum geht, sich zu optimieren.
Ich schreibe aus der Position einer chronisch Kranken, die hofft, dass wir gemeinsam eine radikale (Selbst-)Sorge entwerfen, die so tief in uns allen verankert ist, dass sich Krankheits-Akzeptanz-Kämpfe nicht mehr im eigenen Verhältnis zu politischem Tätigsein abspielen müssen, weil eh klar ist, dass hier alle, die ähnliche Ideale teilen, Platz und Wichtigkeit haben, egal in welcher Form sie wann, wie viel machen. Eine radikale Selbstsorge ist aber nicht nur für chronisch kranke Feminist*innen wichtig, sondern für alle, denn der herrschende Zustand macht uns in Zusammenarbeit mit der verstreichenden Zeit alle – früher oder später, länger oder kurzfristig – schmerzend, ängstlich oder traurig. Damit unsere Kämpfe lange Kraft haben und unsere Leben lebenswert sein können, brauchen wir Werkzeuge, um für uns selbst und füreinander in solchen Situationen da sein zu können.
Dieser Text wurde zuerst in der RosaRot publiziert. www.rosarotzeitschrift.ch
Anmerkungen
1 Es ist oft heikel, ein «wir» vorauszusetzen, denn unsere jeweiligen Erfahrungen hängen von so vielen Faktoren ab. Ich verwende das «wir» einerseits um von mir und meinen kranken Freundinnen zu sprechen, anderseits meine ich all jene, die sich auf diesen Text einlassen, der sich mit chronischem Kranksein und Politik befasst.
2 Ein System als «krank» zu bezeichnen, verwendet eine Lebensrealität von Menschen als Metapher für etwas Schlechtes. Krankheiten als Metaphern zu verstehen, kann sich negativ auf Betroffene auswirken, wie beispielsweise Susan Sontag 1978 in «Illness as Metaphor» gezeigt hat. Das System ist nicht krank, es ist ausbeuterisch und unterdrückend. Und Krankheiten sind, auch wenn sie von Betroffenen oft weggewünscht werden, nicht zwingend schlecht. Sie können neue Perspektiven und Lebensweisen eröffnen. Was uns das Disability-Movement bezüglich Behinderung und sozialer Konstruktion von Barrieren und Zugänglichkeiten gelernt hat, trifft auch bei Krankheiten zu: Das Problem liegt nicht (nur) in den Symptomen, sondern wie damit in einer Gesellschaft umgegangen wird. Die Verwendung des Begriffs des «kranken Systems» an dieser Stelle soll das diesbezügliche Unwissen der Autorin zum Zeitpunkt der beschriebenen Überlegungen anzeigen.