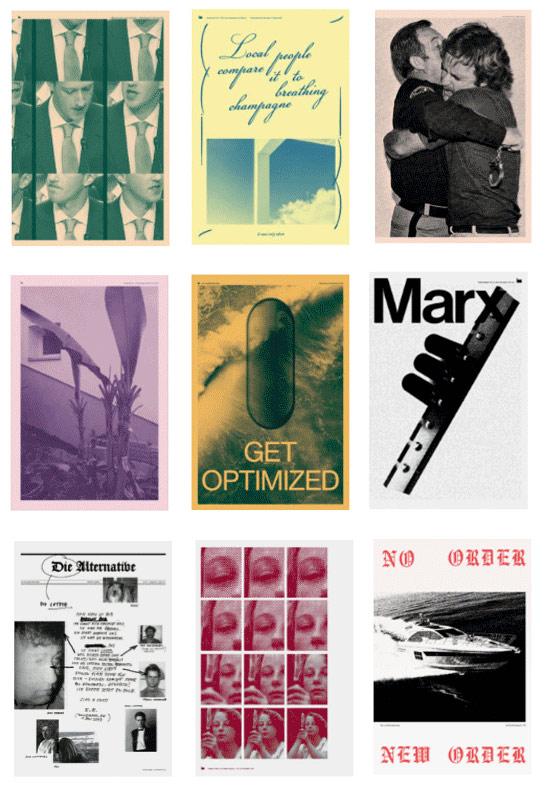Der Kosovo ist der jüngste Staat Europas. Als das Land am 17. Februar 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärte, feierten nicht nur die Menschen in Prishtina – in zahlreichen westeuropäischen Städten jubelte die Diaspora mit. Auch in der Schweiz: Gut 150’000 Kosovarinnen und Kosovaren leben hier; sie zählen nach den Italienern, Portugiesen und Deutschen zu den grössten Ausländergruppen in der Schweiz. Ungefähr ein Drittel der kosovarischen Bevölkerung lebt aktuell laut Schätzungen ausserhalb des Kosovo; damit bildet die weit verstreute Diaspora einen wesentlichen Teil der kosovarischen Gesellschaft.
Der Kosovo erlebte in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Migrationsbewegungen. Die erste grosse Auswanderungswelle fand zwischen 1940 und 1960 statt, als die Kosovo-Albaner in Jugoslawien vor der brutalen Politik von Aleksandar Rankovic flüchteten. Von den 60er bis zu Beginn der 90er Jahre war die kosovarische Migration vor allem eine saisonale Arbeitsmigration in Länder wie Deutschland oder die Schweiz. Deutschland war durch das als Gastarbeiter-Gesetz bekannte Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Jugoslawien nebst der Schweiz zu einem Magneten für Menschen aus Jugoslawien geworden. Von jugoslawischer Seite her hatte man im Rahmen des Gastarbeiter-Gesetzes gezielt Landarbeiter aus ärmeren Gebieten angeworben: Im Kosovo, in Mazedonien und im serbischen Kernland.
Entsprechend bildeten die wenig ausgebildeten Landarbeiter eine relativ homogene Migrantengruppe. Im Laufe der 1980er-Jahre wurde in zahlreichen westlichen Ländern die Visapflicht für jugoslawische Staatsange-hörige eingeführt; ab 1992 wurde die Arbeitsmigration durch die schweizerische Politik eingeschränkt und erschwert. Die schlechtere politische Lage im Kosovo zu Beginn der 90er Jahre führte jedoch beinahe gleichzeitig zu einer dritten Migrationswelle, in der einerseits Familien nachzogen und andrerseits verstärkt politische Flüchtliche um Asyl ersuchten. Gegen Ende der 90er Jahre flüchteten als Folge des Kosovo-Krieges um die 50’000 Kosovaren, oft auch nur kurzzeitig, in die Schweiz. Seit dem Ende des Krieges befindet sich das Land in einem Aufbau, der nicht wirklich vorwärts kommt. Die Erklärung der Unabhängigkeit von Serbien hat dem Land zwar zu Selbstbewusstsein und Anerkennung verholfen. Die wirtschaftliche Isolation hat jedoch dazu geführt, dass die Migration aus dem Kosovo in den letzten Jahren wieder zugenommen hat – und diesen Februar in einer Massenflucht ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Die Bevölkerung ist ernüchtert über die Lage in der Heimat: Die Wahlen im Juni 2014, bei welchen die Regierungspartei ihre Mehrheit verloren hatte, waren für viele Grund zur Hoffnung. Doch diese Träume – zum Beispiel auf ein Ende der Vetternwirtschaft – sind inzwischen gerade bei der Mittelschicht verflogen.
Wie für so viele vor ihnen liegt die Hoffnung auf ein besseres Leben im Ausland – zumindest vorläufig, denn viele ziehen nicht freiwillig weg und wünschen sich eine Rückkehr zu besseren Zeiten. Einmal angekommen, wird es einem nicht leicht gemacht, sich auf die neue Heimat einzulassen. Die Hürden sind bekannt: Viele müssen trotz einer besseren Ausbildung mit wenig privilegierten Arbeiten vorlieb nehmen; Stellensuchende mit Namen aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien werden benachteiligt.
Da scheint es naheliegend, die Zeit in der Schweiz als nur temporär zu betrachten. Geld verdienen und dann wieder zurück – physisch hier, in Gedanken in der Heimat bei der zurückgebliebenen Familie und Freunden – als Bindeglied bleibt die finanzielle Unterstützung, die von der Diaspora in den Kosovo fliesst. In der Zwischenzeit besuchen viele Kosovaren der Diaspora ihr ursprüngliches Heimatland während ihrer Ferien. Dort bezeichnet man die zurückgekehrten Landsleute auch als «Schatzis» – äusserlich an der westlicheren Kleidung und besseren Autos mit schweizer oder deutschem Nummernschild erkennbar. Die Bezeichnung ist dabei gar nicht als schmeichelhaft zu verstehen: Sie gelten nicht mehr als «richtige» Kosovaren und Kosovarinnen. In mehreren Interviews hat die britische Soziologin Dafina Paca versucht, die verschiedenen Bedeutungen, die mit dem Begriff verbunden sind, festzumachen. So findet wegen den vielen nach Deutschland und in die Schweiz ausgewanderten kosovarischen Gastarbeitern mit dem Begriff auch eine gesellschaftliche Hierarchisierung statt; und zu der Diskriminierung, die viele bereits im Exil erleben mussten, kommt eine weitere hinzu.
Welchen Bezug in der Schweiz lebende Kosovaren zu ihrem Herkunftsland haben, wo sie sich zuhause fühlen und inwiefern sie mit dem Schatzi-Stereotyp umgehen, darüber haben wir mit einer gebürtigen Kosovarin und einem gebürtigen Kosovaren in Zürich und Basel gesprochen.
«Schatzi», was verstehen Sie darunter?
Besnik Abazi: Im deutschsprachigen Raum bedeutet der Begriff ja, dass man jemanden gern hat, oder er bezeichnet eine Person, mit der man eine liebevolle Beziehung hat. Nun wird der Begriff im Kosovo in den letzten Jahren ziemlich unterschiedlich verwendet. Er bezeichnet dort eher eine Person, die von wenig eine Ahnung hat und als nicht besonders intelligent angesehen wird. Also ein eher erniedrigender Begriff. Uns Kosovaren, die in der Diaspora leben, bereitet das natürlich keine Freude. In der Regel wird der Begriff vor allem auf Personen angewandt, die bis in die 80er Jahre als Gastarbeiter oder während des Kosovo-Krieges ohne Ausbildung ins Ausland flüchten mussten. Während sie in der Diaspora auf vieles verzichten müssen, können sie sich in Kosova grosszügig verhalten. Sie haben hier in der Schweiz zehn bis elf Monate sehr viel gearbeitet. Zurück im Kosovo möchten einige gerne zeigen, dass es ihnen gut geht. Es ist eine Art Psychohygiene, um die kommenden elf Monate in der Schweiz wieder auf sich nehmen zu können. Die Autos, Markenkleider, Schmuck und letztlich das Verhalten fallen aber nicht nur positiv auf, sondern werden von vielen als überheblich wahrgenommen. Ich denke aber, dass sich dieses Phänomen auch in anderen Gesellschaften zeigt. Ich selbst gehe oft in die Türkei in die Ferien und man sieht auch dort, dass diejenigen Türken, die im Ausland leben, in der Türkei als Auswärtige erkannt werden; sei es alleine durch die Art, wie sie gehen, wie sie angezogen sind oder schlussendlich einfach, ob man jemand Unbekanntem die Tür offen hält. Viele solche Verhaltensweisen sind im Westen stark unterschiedlich. Diese Routinen legt man nicht von einem zum anderen Tag ab.
Shqipe Bajrami-Grohs: Als «Schatzi» – ich habe es öfter im albanischen Plural (Shacat) gehört – werden die ausgewanderten Kosovaren und Kosovarinnen, die in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz leben, bezeichnet. Es ist ein negativ konnotiertes Wort, das vor allem für die Heimatbesucher mit europäischen oder schweizer Nummernschildern im Sommerurlaub gebraucht wird.
Was denken Ihre Freunde und Verwandten im Kosovo von Ihnen? Welches Bild haben diese von Ihnen?
Besnik Abazi: Mir selbst ist es noch nie passiert, dass ich von jemandem als Schatzi bezeichnet wurde; ich kenne aber viele Bekannte, denen es so ergangen ist. Wir in der Diaspora sind dabei nicht ganz unschuldig, wenn wir uns hier anders verhalten als dort. Meine Bekannten kämpfen in der Schweiz mit vier bis fünf Kindern und vier- bis sechstausend Franken Einkommen ums finanzielle Überleben. Im Kosovo möchten sie eine andere Seite von sich zeigen; sie gehen dafür sogar so weit, dass sie Kleinkredite für die Ferien im Sommer aufnehmen. Als ich selbst noch im Kosovo war, hatte darum auch ich ein falsches Bild der Diaspora. Ich dachte, diejenigen, die in der Schweiz leben, sind bei der Arbeit integriert und verdienen gutes Geld. Einer meiner Cousins arbeitete im Restaurant und verdiente dort ca. 2200 Schweizerfranken pro Monat. Als junger diplomierter Arzt mit einjähriger Berufserfahrung hätte ich im Kosovo damals umgerechnet lediglich 100 bis 200 Franken verdient. Ich dachte mir, dass er nach fünf Jahren 100’000 Franken gespart haben wird. Dass ihm nach den hohen Kosten für Krankenkasse, Wohnung, Versicherung etc. nur noch wenig bleibt, war mir damals nicht bewusst. Diese Ansichten ändern sich jeweils bei vielen Kosovaren dann, wenn sie als Touristen zu Besuch in die Schweiz kommen. Sie sehen, wie viele Dinge hier anders funktionieren. Als mein Vater einmal bei mir zu Besuch war, habe ich ihm erklärt, wie wenig mir nach allen Kosten noch übrig bleibt. Er fragte sich daraufhin, wieso so viele Kosovaren dann überhaupt noch in der Schweiz bleiben. Es sind letztlich oft auch die neuen Lebensgewohnheiten, die die Menschen hier halten. Es gibt in der Diaspora viele, die sich mitten in der Integration befinden; diese Menschen sehen sich sowohl hier wie auch im Kosovo als Ausländer. Sie sind aus der alten Heimat entwurzelt, aber in der neuen Heimat noch nicht angekommen.
Shqipe Bajrami-Grohs: Die meisten meiner Freunde sind entweder ausgewandert oder im Krieg getötet worden. Ein paar, die in Kosova geblieben sind und mit denen ich noch Kontakt habe, schätzen meine Leistung sehr.
Sie haben Ihre Kindheit im Kosovo verbracht und sind erst als junger Erwachsener in die Schweiz gekommen. Wie waren für Sie die ersten Erfahrungen in der Schweiz?
Besnik Abazi: Das war für mich nicht einfach. Es war ein Kulturschock, unter anderem auch wegen der vielen Kleinigkeiten im Alltag, die anders waren. In der Schweiz ist es so, dass man den Wohlstand weniger herumzeigt. Dass eine Milliardärin wie Gigi Oehri hier in Migros, Coop oder Denner einkaufen geht, könnte man sich in Kosova nicht vorstellen. Als ich als junger Arzt damals in die Schweiz gekommen bin, ging ich davon aus, dass mir alle Türen offenstehen werden. Ich wurde allerdings schon bei der Wohnungssuche und den Schwierigkeiten mit Hochdeutsch und Schweizerdeutsch relativ rasch auf den Boden der Realität geholt. Statt einer Stelle als Assistenzarzt musste ich zuerst als Psychiatriepfleger anfangen. Wenn ich Vorträge in der Klinik besuchte, war ich jeweils der erste, der sich meldete, wenn der Referent fragte, ob er auf Hochdeutsch sprechen soll. Mittlerweile verstehe ich Schweizerdeutsch sehr gut und ich spreche eine Mischung aus Hoch- und Schweizerdeutsch. Aber auch nach zwanzig Jahren in der Schweiz, wo ich mittlerweile Familie und Kinder habe, kann es am Zoll noch vorkommen, dass ich geduzt werde.
Shqipe Bajrami-Grohs: Ich kam mit zwanzig in die Schweiz, als Familiennachzug. Es gab damals kein Willkommenspaket und auch keine Begrüssungs- und Informationsveranstaltungen für Neu-
zuzügler. Es war eine sehr harte Zeit. Wir kannten niemanden. Wir hatten weder Verwandte noch Bekannte in der Nähe. Wir wurden erst nach drei Monaten in einen Deutschkurs geschickt. In der Zeit wollte ich zurück nach Hause gehen, aber wegen der schlechten politischen Lage (kurz vor dem Krieg) konnte ich nicht. Da wir die Sprache des Landes nicht konnten, war es sehr schwierig, mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen. Mit grossem Willen und Ambition haben wir es geschafft, schnell die Sprache zu lernen. Die Universität und die Arbeit haben mir die schnelle Integration ermöglicht. Dort habe ich die Freunde fürs Leben gefunden, mit denen ich immer noch heute die meiste Freizeit verbringe.
Mittlerweile leben Sie seit gut zwanzig Jahren in der Schweiz. Wo fühlen Sie sich zuhause?
Besnik Abazi: Noch vor zehn Jahren hatte ich den Eindruck, hier nicht wirklich integriert zu sein. Heute ist es so, dass ich mich nicht nur unter Freunden oder bei der Arbeit, sondern auch in alltäglichen Situationen integriert fühle. Ich fühle mich heute schon in der Schweiz zuhause. Allerdings lässt sich das nicht eindeutig beantworten. Wir haben ja Glück, dass wir in der Diaspora zwei Heimaten haben. Das kann natürlich auch belastend sein, vor allem wenn es an einem Ort z.B. wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt. Dann bedrückt mich das selbstverständlich.
Shqipe Bajrami-Grohs: Zuhause fühle ich mich in Zürich. Hier habe ich studiert und arbeite ich seit 15 Jahren. Hier habe ich sowohl meinen Freundeskreis als auch meine Familie. Ich bin mit Zürich verbunden und verwurzelt. In Zürich wähle ich und stimme ab. Es ist ein Privileg! Hier setze ich mich aktiv mit der Politik auseinander. Die Nationalratswahlen 2015 haben für mich eine zentrale Bedeutung: Ich kandidiere für den Nationalrat.
Zu Beginn Ihrer Zeit in der Schweiz, war es für Sie eine temporäre Angelegenheit mit Absicht zur baldigen Rückkehr oder war klar, dass Sie hier bleiben werden?
Besnik Abazi: Obwohl ich rasch Deutsch lernte und mich integrieren wollte, lebte ich für etwa zehn Jahre in dem Gefühl, dass ich zurückkehren werde. Nach zwanzig Jahren war dieses Gefühl schliesslich verschwunden. Ich konnte nicht mein ganzes Leben auf dem Koffer sitzen, wie man so sagt. Ich musste einen Schlusstrich ziehen. Ich werde hier gebraucht, beispielsweise in meiner Arbeit in der Psychiatrie, in der ich auch mit vielen Albanern arbeite.
Shqipe Bajrami-Grohs: Ich hatte die Absicht zu einer baldigen Rückkehr. Wir dachten, dass die politische Lage in Kosova sich verbessern würde und wir nach drei Monaten nach Hause zurückkehren könnten. Ich hatte meine Bücher mitgenommen und wollte im folgenden September die Prüfungen an der Uni in Prishtina ablegen.
Unterstützen Sie Ihre Verwandten, die im Kosovo leben, in finanzieller Hinsicht?
Besnik Abazi: Meiner Mutter, meiner Schwester und einem Cousin, mit dem ich aufgewachsen bin, und die alle noch im Kosovo leben, fühle ich mich durchaus verpflichtet.
Shqipe Bajrami-Grohs: Ich unterstütze ab und zu drei meinen Cousinen, die noch studieren, deren Väter im Krieg erschossen wurden. Meine Onkel haben uns sehr viel geholfen, als mein Vater aus politischen Gründen von der serbischen Polizei verfolgt wurde und fliehen musste. Es ist also vielmehr ein Zurückgeben und Dankeschön für die Hilfe von meinen Onkeln, die leider nicht mehr leben. Diese Unterstützung wird sehr dankbar angenommen.
Gibt es bei der im Kosovo lebenden Bevölkerung falsche Vorstellungen über das Leben im Ausland, z.B. in der Schweiz?
Shqipe Bajrami-Grohs: Meinen Sie, dass das Geld von den Bäumen fällt? Ja, sowas gibt es auch. Aber die Mehrheit hat direkt oder indirekt eine Verbindung zur Schweiz und weiss ziemlich genau, wie das Leben bei uns in der Schweiz funktioniert.
Reisen Sie noch regelmässig in den Kosovo zu Ihren Verwandten oder Bekannten?
Shqipe Bajrami-Grohs: Ich reise nicht so oft nach Kosova. Aus politischen Gründen durfte ich erst nach 14 Jahren reisen. Seitdem war ich drei Mal privat dort und einmal beruflich.
Wie sieht es mit Aktivitäten in kosovarischen Gemeinschaften in der Schweiz aus?
Besnik Abazi: Das war für mich sehr wichtig, vor allem in der Zeit bevor der Kosovo-Krieg ausgebrochen ist. Ich hatte es mir in dieser Zeit zur Pflicht gemacht, Hilfe zu leisten, indem ich Geflüchteten half, ihre Verfolgung zu beweisen. Ich war auch bei einem Verein engagiert und sprach dort viel vor den Medien. Dabei war auch ein Fall, bei dem zwei Kosovaren nach ihrer Rückkehr erschossen wurden. Da war für mich klar, dass ich mich dafür einsetzen musste, dass es nicht weiteren Menschen so ergeht. Aus beruflichen Gründen habe ich mich dann vor ca. zehn Jahren aus vielen Bereichen zurückgezogen. In den Spezialgebieten der Migration, z.B. der transkulturellen Psychiatrie, bin ich aber weiterhin aktiv.
Shqipe Bajrami-Grohs: Ich war von Anfang an bei unterschiedlichen Aktivitäten in der albanischen Community engagiert. Ich habe für die traumatisierten Kriegsflüchtlinge gedolmetscht und albanischen Familien mit geringen Deutschkenntnissen mit Übersetzungen geholfen. Bei der Gründung des albanischen Studentenvereins an der Uni Zürich war ich dabei. Ich war Mitglied der Koordinationsgruppe für die Gründung einer albanischen Organisation in der Schweiz. Bis vor kurzem war ich Koordinatorin des Aufsichtsrats des Dachverbands der Albanerinnen und Albaner der Schweiz.