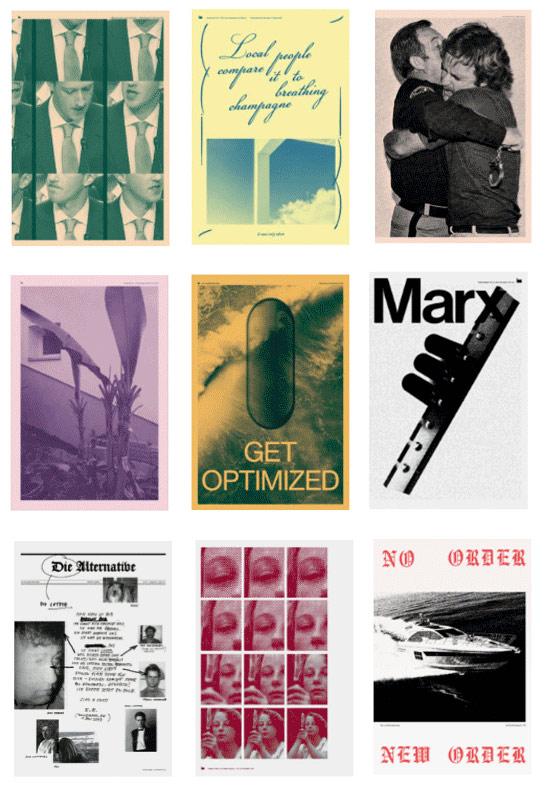Shivaraju B.S. alias Cop Shiva ist seit Anfang Oktober als Artist in Residence in der Roten Fabrik. Das Leben in den Strassen von Bangalore bietet dem Fotografen vielfältigen Stoff für seine dokumentarischen Serien. Im Gespräch erzählt er von seiner Herkunft, seinen künstlerischen Themen und Strategien und was ihm am Reisen gefällt.
Eveline Suter (ES): Dein Künstlername ist Cop Shiva. Warum nennst du dich so?
Cop Shiva (CS): Ich bin im wunderschönen Dorf Ramnagaram in Karnataka aufgewachsen, wo der Bollywood-Film «Sholay» gedreht wurde. Ich stamme aus einer Bauernfamilie, doch das bäuerliche Leben ist hart und oft unvorhersehbar. Daher schien es ratsam, eine staatliche Stelle anzustreben und als ich mich bewarb, erhielt ich eine Stelle als Polizeibeamter.
Als ich nach Bangalore zog, begann ich mich im alternativen Kunstzentrum 1Shantiroad zu engagieren. Dort traf ich unzählige interessante bildende Künstlerinnen, Studenten, Filmemacherinnen und Fotografen, die mich beeinflussten. Ich dokumentierte jeweils die Projekte und Anlässe und merkte dabei, dass ich die Fotografie künstlerisch nutzen will. Die Künstler-Community in Bangalore gab mir darauf den Übernamen «Cop Shiva» und ich bin bis heute dabei geblieben.
ES: Dein Thema sind die Menschen, ihr Leben, ihr alltäglicher Überlebenskampf wie auch die Fluchten aus dem Alltag und die farbenfrohen Feste. Du hast Arbeitsmigranten in Bangalore porträtiert («The Street as Studio»), einen Gandhi-Darsteller begleitet und lokale Volksbräuche dokumentiert («Ecstasy»). Wie findest du die Themen für deine Serien?
CS: Als Fotograf bin ich vor allem in den Strassen unterwegs. Ich versuche, die Menschen und ihre Emotionen im Alltag wie in besonderen Situationen festzuhalten. Mein Portfolio umfasst intime Porträts von städtischen Migrantinnen, Transgender-Menschen, Strassen-Performer und jenen, die am Rande der Gesellschaft und des Zeitgeistes leben. Mit meiner Kunst möchte ich gesellschaftliche Diskussionen zu diesen Minderheiten anregen und die einfache Frau, den einfachen Mann als Helden zeigen.
Ausgehend von meiner Herkunft aus einfachen Verhältnissen und der eigenen Migrationserfahrung begann ich, die Menschen an den Rändern der Gesellschaft zu porträtieren. Meine Erfahrung als Bauer, als Polizist sowie als Koordinator eines Kunstraumes helfen mir dabei, mit Menschen aller Schichten in Kontakt zu kommen und in verschiedene Lebenswelten einzutauchen. Wenn man Kontakt zu verschiedenen Menschen pflegt und sich für ihre Alltagsprobleme interessiert, entwickelt man mehr Mitgefühl und Verständnis. Ich möchte Realitäten zeigen, die in der Gesellschaft wenig beachtet werden. Es gibt viele Alltagshelden, engagierte Personen, die hart arbeiten, um die Gesellschaft zu verändern, die Gleichberechtigung zu fördern und Gerechtigkeit in ihrer unmittelbaren Umgebung herzustellen. Sie agieren im Kleinen und erscheinen nicht in den Schlagzeilen, aber sie bewirken echte, positive Veränderungen. Es ist mir ein Anliegen, sie einem grösseren Publikum vorzustellen.
ES: Und wie findest du konkret die Personen, die du porträtierst?
CS: Wenn ich auf den Auslöser drücke, habe ich normalerweise bereits eine längere Reise mit der Person vor der Kamera unternommen. Wir haben Zeit zusammen verbracht, um uns näher zu kommen. So entsteht eine natürliche Situation, in die der Moment des Fotografierens wie selbstverständlich integriert ist. Ich versuche als Fotograf fast unsichtbar zu werden, mich zurückzunehmen, um so die Essenz einer Person zu erfassen.
ES: «The Street as Studio» widmet sich den Arbeitsmigranten in Bangalore in einer Mischung aus Dokumentation und Inszenierung. Wie bist du dieses Thema angegangen?
CS: Bangalore ist eine Stadt voller Migrant*Innen mit ihren Träumen. Als Polizist habe ich ihre Hoffnungen und Existenznöte gesehen. Ich arbeite seit vielen Jahren an dieser Serie, die von der Idee ausgeht, dass Migrant*Innen eine fragmentierte Beziehung zum neuen Wohnort haben. Die Idee von zu Hause existiert für sie meist nur in der Vorstellung und doch versuchen sie auf kleinsten Flächen, so etwas wie ein intimes Heim zu schaffen. Ich lerne die Menschen erst über Monate kennen, bevor ich sie fotografiere und notiere ihre Geschichte, die so integraler Bestandteil des Bildes wird. Für die Serie nutze ich Wandmalereien im öffentlichen Raum, mit denen die Stadtregierung Bangalore «verschönern» wollte. Es sind schrille Bilder von Baudenkmälern, exotischen Tieren, Göttinnen und Göttern sowie spektakulären Landschaften. Sie alle stehen in krassem Kontrast zum Leben der Migrantinnen und Migranten, die sich abmühen für ein kleines Einkommen und ein bisschen Intimität. Die Studiofotografie benutzt traditionell gemalte Hintergründe, vor denen die Leute posieren. An diese Art von romantischer Studiofotografie knüpfe ich an und mache die Porträtierten zu Protagonisten einer traumartigen Szene.
ES: «Being Gandhi» ist eine andere umfangreiche Serie, die dir schon viel Beachtung eingebracht hat. Sie ist jedoch nur einem Mann gewidmet. Wer ist das? Und warum interessierst du dich für ihn?
CS: Der magische Realismus hat mich stark beeinflusst. Ich fokussiere auf die exzentrischen Aspekte der Realität, die oft übersehen werden, und zeige den öffentlichen Auftritt als Maskerade und Performance. «Being Gandhi» ist ein gutes Beispiel dafür.
Bagadehalli Basavaraj ist ein Lehrer, der aus extrem armen Verhältnissen stammt. Nur dank der Unterstützung einer anderen Familie, die Gandhis Lehren folgte, erhielt er seine Ausbildung. Seit 15 Jahren verwandelt er sich immer wieder in eine lebendige Gandhi-Statue: Er bemalt sich mit Silberfarbe, wickelt sich ein Dhoti (indisches Lendentuch) um und setzt eine runde Drahtbrille auf. Mit einem Stock in der Hand geht er so durch Dörfer und Städte, wo er mit Leuten spricht oder auch nur für Stunden still da steht. Manche glauben, er wäre ein Bettler und werfen ihm Geld zu, andere halten ihn für verrückt und wieder andere beten.
Ich dokumentiere seine Ausflüge bereits seit acht Jahren. Es ist faszinierend und inspirierend, wie jemand aus bescheidenen Verhältnissen zu einem Gandhi-Experten geworden ist und vor allem eine so geistreiche und eigenständige Form von sozialem Aktivismus entwickelt hat. Mit Farbe und einfachen Objekten verwandelt er sich in ein extrem starkes Bild, das zwar grosse physische und mentale Kraft erfordert, aber auch bei den Menschen haften bleibt. Gandhis Prinzipien, die hauptsächlich auf Brüderlichkeit und Gleichheit basieren, fordern das Kastensystem heraus, das seit vielen Generationen eine schwere Last für Indien bedeutet. Seine Prinzipien geraten aber leider immer mehr in Vergessenheit. Basavaraju nimmt in Kauf, ausgelacht zu werden, für das, was er tut, aber seine spirituelle Energie gibt ihm Kraft, Gandhis Lehre gegen alle Widrigkeiten zu verbreiten. Basavaraju ist insofern ein gutes Beispiel für die alltäglichen Helden, die in meiner Arbeit die Hauptrolle spielen.
ES: Du bist in den letzten Jahren viel gereist, hattest eine Residency in Berlin 2015 und eine in Göteborg 2017. 2015 warst du das allererste Mal in Europa, als du zwei Serien in der Ausstellung «One and one make eleven» im Kunsthaus Langenthal gezeigt hast. Was hat dich damals überrascht oder irritiert? Und hat sich das unterdessen verändert?
CS: Bei meinem ersten Europa-Aufenthalt war ich sehr aufgeregt. Die Erfahrung hat mich überwältigt. Ich musste neue Verhaltenscodes lernen und einen Weg finden, mich in der unbekannten Gesellschaft zu bewegen. Zum Glück hatte ich gute Freundinnen in der Schweiz, die mir halfen, durch ihr Land und ihre Kultur zu navigieren. Nach diesem ersten kurzen Besuch, habe ich nun dank Pro Helvetia die Gelegenheit länger in der Schweiz zu sein und es fühlt sich tatsächlich anders an. Denn ich bin besser ausgerüstet, um in die kulturellen und künstlerischen Welten der Schweiz einzutauchen und so auch mehr für meine künstlerische Arbeit daraus zu gewinnen.
ES: Wie erlebst du den Aufenthalt als Artist in Residence in der Roten Fabrik? Du hast ja hier ein Studio in einem kulturellen Umfeld, zu dem du auch in Verbindung treten kannst.
CS: Ein fremdes Land, eine fremde Kultur, das kann durchaus Angst machen, aber Reisen macht auch offener, fördert das Verständnis für Menschen und die verschiedenen Kulturen. Es lehrt einen, nicht immer gleich über andere Menschen zu urteilen. In einer kulturellen Institution wie der Roten Fabrik zu arbeiten, gibt mir die notwendige Infrastruktur und noch mehr die emotionale Unterstützung, um in die zeitgenössische Kunst hier in der Schweiz und insbesondere in Zürich einzutauchen. Hier kann ich mit Menschen mit ähnlichen Interessen und künstlerischen Strategien zusammenkommen, mich austauschen und im besten Fall Synergien für einen fruchtbaren kulturellen Austausch nutzen. Die Erfahrungen hier sind für mich persönlich wie für meine Arbeit extrem bereichernd.