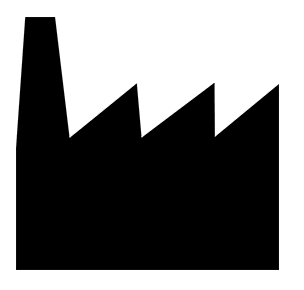Ein Streifzug durch die Geschichte der Vereine in der Schweiz, ihren Färbungen und Funktionen, die eng mit dem Verständnis von Staat und Öffentlichkeit, Selbstorganisation, Identitäten sowie Interessen – und nicht zuletzt mit Genderpolitik und Moral verwoben sind.
Sich frei zusammenschliessen, um Wissen zu teilen, zu bereden, was los ist in der Welt, welche Fragen drängen und wie man sie lösen und die Gesellschaft verändern könnte: Darum geht es jenen Leuten, fast ausnahmslos jungen Männern, die um 1700 so genannte Sozietäten oder Gesellschaften gründen. Um nicht viel anderes geht es heute, wenn sich Leute zusammentun, um «Urban Gardeners» zu werden oder sich für den Klimaschutz zu engagieren. In den gut 300 Jahren dazwischen haben freiwillige Zusammenschlüsse – nichts anderes sind Vereine – viele Formen angenommen und ebenso vielfältige Ziele verfolgt. Nicht zuletzt haben sie, im Gegensatz zu den Anfängen, eine gesetzliche Grundlage bekommen.
1700: Einen Raum zwischen Individuum
und Staat schaffen
Die Geschichte des modernen Vereins beginnt in der europäischen Aufklärung. Um 1700 entstehen erstmals freiwillige
Vereinigungen von Privatpersonen, die gemeinsam einen bestimmten Zweck verfolgen. Sie sind Anhänger von republikanisch-demokratischen Staatsauffassungen – leben indessen noch in einer Zeit, in der die Regierungen in der Hand von aristokratischen Familien, absolutistisch agierenden Obrigkeiten, Königen und Kaisern liegt.
Diese Zusammenschlüsse nennen sich Gesellschaften oder Sozietäten, in Anlehung an das lateinischen Wort «societas». Sie schaffen eine neue Form gesellschaftlicher Selbstorganisation. Neu ist, dass sie sich auf privatrechtlicher Basis durch einen Vertrag verbinden. Zuvor gab es nur öffentlich-rechtliche Körperschaften, wie etwa Zünfte, denen die Einzelnen nicht durch freien Entscheid, sondern durch Beruf und Familie angehören. Neu ist auch, dass die Sozietäten erstmals eine öffentliche Sphäre schaffen, das heisst einen Raum zwischen dem Individuum und dem Staat, in dem über Fragen von allgemeinem Interesse debattiert oder auch konkrete Projekt an die Hand genommen werden können. Heute sagen wir dazu Zivilgesellschaft.
Die Schweiz spielt in der Sozietätenbewegung, die zu dieser Zeit ganz Europa sowie Nord- und Südamerika erfasst, eine zentrale Rolle. Zahlreiche Intellektuelle sind im damaligen deutschen Kaiserreich oder im royalistischen Frankreich Mitglieder wissenschaftlicher Akademien und stehen in regem Briefwechsel. In ihrer Heimat gründen sie selber zahlreiche eigene Sozietäten. Für das 18. Jahrhundert sind rund 400 bekannt, manche existieren nur für kürzeste Zeit, andere etablieren sich langfristig (wie etwa die Ökonomische und Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Bern).
Das Interessensspektrum der Sozietäten ist sehr breit. Es reicht von Wissenschaft, über Literatur, Sprache und Volksbildung bis hin zu Gesundheit und sozialen Fragen. Doch etwas verbindet sie: Alle zielten sie darauf, eine neue Moral zu etablieren. Es ist das Gebot der Stunde, denn die aufklärerische Befreiung der Menschen aus tradierten Ordnungssystemen und Glaubenssätzen schafft Bedarf an ethischer Orientierung – nach einem verbindlichen Wertekanon in allen Fragen des menschlichen Zusammenlebens.
Überhaupt rückt im aufgeklärten Denken, – das davon ausgeht, dass die Gesellschaft menschengemacht ist und nicht durch Gott, Könige, Kirchen oder unabänderliche Traditionen bestimmt wird – ‚der Mensch‘ in allen Facetten ins Zentrum des Interesses, angefangen bei seiner Gesundheit bis hin zu seiner sozialen Verantwortung.
Das damit verknüpfte Postulat der prinzipiellen Gleichheit aller Menschen stellt bestehende Ungleichheiten infrage, nicht zuletzt jene zwischen Frauen und Männern. Doch die Aufklärung führt, wie wir wissen, nicht zur rechtlichen Gleichstellung, sondern im Gegenteil dazu, die Ungleichheit von Mann und Frau neu zu begründen und unter Rückgriff auf das Naturrecht in wissenschaftlicher Manier gar zu bekräftigen.
Auf der Suche nach ethisch-moralischen Grundsätzen orientieren sich die Sozietäten grundlegend an der Abkehr des als dekadent empfundenen Lebensstils der Aristokratie, ganz besonders der französischen, die bekannt für ihren Luxus und ihre Freizügigkeit im Liebesleben ist. Dagegen lobt die aufklärerische Moral Nüchternheit, Enthaltsamkeit, Abhärtung, Produktivität, Kontrolle, Disziplin und Vaterlandsliebe. Diese neue moralische Haltung kultiviert vor allem der englische Puritanismus. Die schweizerischen Sozietäten orientieren sich daran.
Die Erfindung der Sozietäten bringt also eine zweifache – und zweischneidige – Erneuerung mit sich: Die freie Vereinigung Gleichgesinnter ist einerseits eine Errungenschaft, die die grundsätzliche Möglichkeit schafft, dass Privatpersonen – und nicht nur die Obrigkeit – über Fragen von öffentlichem Interesse verhandeln können. Andererseits verschreiben sich die Sozietäten der neuen Moral, aus der sie hervorgegangen sind. Sie debattierten denn auch über alles – nur nicht über die Ausrichtung ihres ethischen Wertekanons. Freie, private Vereinigungen stehen daher von Anfang an in einem Spannungsfeld: einer emanzipatorischen, selbstermächtigenden und in diesem Sinn fortschrittlichen und freiheitlichen Ausrichtung einerseits – und einer erziehenden, bevormundenden, lenkenden und bewahrenden Haltung.
1830: Die Sänger, Schützen, Turner treten auf
– und die Frauen
Das 19. Jahrhundert wird zur Geburtsstunde der bürgerlichen Vereine. Sie treten in die – zweifachen – Fussstapfen der Sozietäten. Rechtlich und organisatorisch leiten sie daraus die noch heute gängige Rechtsform des Vereins mit seinen Vorgaben für Gründung, Organisationsform und Statuten ab. Sie sind ebenfalls ein Hort liberaler und republikanisch-demokratischer Gesinnung. Im Unterschied zu den gelehrten Sozietäten sind sie vor allem praktisch tätig. Sie pflegen Männergesang, sind Schützen und Turner, oder sie engagieren sich für soziale Fragen, Volksbildung und Gesundheit, für die Förderung von Kunst und Theater.
Unbestritten stellen sie sich in die Tradition aufklärerischer Moral. Bildung und sittliche Erziehung, Körperertüchtigung und Disziplin, Gemeinsinn und Vaterlandsliebe sind verbindende und verbindliche Werte. Anders als ihre nüchternen Vorgänger legen sie, inspiriert von der literarischen Epoche der Empfindsamkeit um 1800, Wert auf gefühlsbetonte Ausdrücke und zwischenmenschliche Bindungen. Bezeichnungen wie Bund und Verein werden beliebt, Sozietät oder Gesellschaft wirken dagegen gefühlskalt und kommen ausser Mode.
Die ersten liberalen Vereine entstehen in den 1820er-Jahren. Nach 1840 entwickeln sie sich von elitären zu populären Vereinigungen, in denen nicht mehr nur Ärzte, Advokaten, Pfarrer, Stadträte und Ökonomen anzutreffen sind, sondern auch Lehrer, Handwerker oder Gastwirte. Vor allem die Sänger werden zusammen mit den Blasmusikern zu einem Breitenphänomen. Grossanlässe, wie die eidgenössischen Schützenfeste, sorgen für Vernetzung und vermitteln die Botschaft nationaler Inklusion.
Im Kontrast dazu steht die Tatsache, dass der Verein als Instrument der Selbstorganisation lange Zeit längst nicht der ganzen Bevölkerung zugänglich ist. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts bleibt er weitgehend liberalen Männer vorbehalten, das heisst faktisch Männer reformierter Konfession mit einem gewissen Bildungshintergrund und ebensolchem Vermögen oder Einkommen. Arbeitern und Handwerkern, die eigene Zusammenschlüsse gründen wollen, erwecken zunächst Misstrauen. Die Kantone legen ihnen Steine in den Weg. Die Situation bessert sich nach 1848 – die Bundesverfassung garantiert erstmals die Vereinsfreiheit –, doch in der Praxis setzt sich eine tatsächliche Vereinsfreiheit erst nach 1860 durch.
Für Frauen sieht die Situation anders aus. Da die meisten nicht ohne Zustimmung von Ehemann oder Beistand Verträge abschliessen können, ist es ihnen auch nicht möglich, selbstständig einen Verein zu gründen. Dennoch sind Frauen in der Vereinswelt ab den 1830er-Jahren präsent. Denn ab diesem Zeitpunkt initiieren bürgerlich-liberale Männer gemeinnützige Frauenvereine und weisen so ihren Ehefrauen und Töchtern – entsprechend der dualen Geschlechterordung – soziale Aufgaben zu.
Bürgerliche Frauen engagieren sich in der Folge in der Mädchenerziehung, organisieren den Handarbeitsunterricht in den Schulen, kümmern sich um die Resozialisierung von Gefangenen und vieles mehr. Sie folgen dabei derselben aufklärerisch-bürgerlichen Moral. So ermahnen sie etwa Frauen und Mädchen der Unterschichten zu Arbeitsamkeit und Keuschheit, um die Geburten zu verringern. Diese Aufgaben versetzen die Mitglieder bürgerlicher Frauenvereine in die Rolle von sozialen Überwacherinnen und schärfen ihr Bewusstsein für ihre Rolle in Staat und Gesellschaft.
Ab 1875 bauen sie ihre Positionierung noch aus. Nach dem Vorbild der englischen Abolitionistenbewegung nehmen sie den Kampf gegen die legalisierte Prostitution auf. Die Sittlichkeitsvereine haben enormen Zulauf und formieren sich bald zu einem nationalen Dachverband, der zum Ansprechpartner des Bundes wird. Im Unterschied zu ihrem abolitionistischen Vorbild bekennen sich aber nur wenige Sittlichkeitsvereine auch zur Bekämpfung der sexuellen und rechtlichen Diskriminierung der Frauen. Eine Mehrheit ist einer konservativen Werthaltung verpflichtet und verfolgt keine emanzipatorischen Ziele.
1880: Der Verein boomt, die staatliche Verflechtung auch – und der Sport
Der Höhenflug der Sittlichkeitsvereine fällt in eine Zeit, in der die Schweizer Vereinslandschaft schubartig wächst. Schätzungsweise die Hälfte der rund 30’000 Vereinsgründungen des 19. Jahrhunderts erfolgen nach 1880. Zugleich verändert sich die Färbung der Vereinswelt. Der Verein ist nicht mehr die alleinige Domäne liberaler Männer, verbunden mit dem Anspruch eine nationale Integrationskraft zu sein. Er wird jetzt zu einem Instrument der Selbstorganisation breiter Schichten und dient verschiedensten Zielen. Dabei fällt auf, dass verschiedene Akteure in Wirtschaft, Kultur und Politik die Vereinsform als Instrument benutzen, um ihre gruppenspezifischen Interessen innerhalb des nun etablierten Nationalstaats zu verfolgen. Bereits im Vorfeld der umstrittenen Revision der Bundesverfassung 1874 formieren sich Wirtschaftsvertreter und Parteigänger in Interessenverbänden wie dem Schweizerischen Industrie- und Handelsverein (heute: Economiesuisse). Dasselbe tun katholisch-konservative Parteigänger und viele weitere Gruppierungen.
Nach 1880 setzt sich dieser Trend fort. Der Bund fördert ihn. Da er seit 1874 erweiterte gesetzgeberische Kompetenzen hat, selber aber weder über die notwendigen administrativen Kapazitäten noch über die Autorität verfügt, delegiert er viele Aufgaben, wie statistische Erhebungen und Umfragen, an Verbände wie auch an die neu entstehenden Gewerkschaften und entschädigt sie dafür mit Bundessubventionen. Das führt zu einer engen Verflechtung. In kleinerem Umfang besteht sie schon seit etwa 1860, als der Bund beginnt, einzelne Vereinssparten zu subventionieren und sie als Dienstleister in Staat und Verwaltung einzubinden. Neben landwirtschaftlichen Vereinen sind das vor allem die Schützenvereine. 1874 überträgt der Bund den Schiessvereinen gar die Durchführung der jährlichen obligatorischen Schiessübungen und bezieht sie so in die Sicherstellung der offiziellen Wehrfähigkeit ein. 1883 bestimmt er weiter, dass «das Obligatorische» ausschliesslich in freiwilligen Schiessvereinen zu absolvieren sei – und zwingt so alle wehrpflichtigen Männer zum Beitritt in einen Schiessverein. Das verschafft diesen enorme Mitgliederzahlen und eine Sonderstellung, die erst 1996 endet.
In die Phase des Booms fällt nicht zuletzt die rechtliche Kodifikation des Vereins. Im Zug der Erarbeitung eines eidgenössischen Zivilgesetzbuches, das 1912 in Kraft tritt, entstehen die bekannten Artikel 60-64, die das moderne Vereinsrecht formulieren.
Der Erster Weltkrieg, der als internationaler Wirtschaftskrieg auch die Schweiz in ihren Grundfesten erschüttert, geht an der Vereinswelt nicht spurlos vorbei. Viele Vereine stellen ihre üblichen Aktivitäten ein. Sozial Tätige haben hingegen viel zu tun und werden zahlreich neu gegründet. Nach Kriegsende zeigt sich die soziale und politische Zerrissenheit, die im Landesgeneralstreik ihren Höhepunkt gefunden hat, auch in der Vereinswelt.
Es entstehen einerseits reaktionäre Bürgerwehren, andererseits fördert der kulturelle Umbruch die Akzeptanz von Sport. Steigende Konsumkraft und vermehrte Freizeit fördern generell das Vereinsleben. Fussball steigt in der bürgerlichen Werteskala von einer unnützen Zeitverschwendung in den Rang eines gesunden, den Körper ertüchtigenden Sports auf. Das verdankt er nicht zuletzt dem Umstand, dass das Militär Fussball nach 1920 als Ausgleichssport in die Ausbildung integriert. Ausserdem erlangt auch das Frauenturnen gesellschaftliche Akzeptanz. Ab Ende der 1920er entstehen Damenriegen innerhalb der Männerturnvereine. Selbstständig werden diese aber erst nach 1960. Bis dahin bleibt die Vereinswelt weitgehend geschlechtergetrennt. Darin spiegelt sich die generelle Entwicklung der Vereinswelt im 20. Jahrhundert: Die in den 1930er-Jahren zunehmende patriotische Orientierung und kulturkonservative Enge stützt die etablierte, stark bürgerlich geprägte Vereinswelt. Ihre grosse Erschütterung erlebt sie nach 1960.
1960: Der lange Abschied vom bürgerlichen Verein
Die 1960er-Jahre sind in der ganzen westlichen Welt, vorab in den USA, Jahre der Rebellion und Revolte. In der Schweiz stellt eine jüngere Generation bürgerlicher Intellektueller erstarrte gesellschaftliche Normen, Arbeitsethos, traditionelle Geschlechterverhältnisse und Autoritätsgebaren radikal in Frage. Ins Visier geraten das Militär als Manifestation staatlicher Autorität, die Verflechtung von Wirtschaft und Politik und die vielfach ausgehebelten demokratischen Entscheidungsprozesse.
Wenig später greifen linke Intellektuelle und Sozialkritiker gesellschaftliche Fragen rund um Solidarität, Gerechtigkeit, Ungleichheit, Hilfeleistung und den Erhalt von Lebensgrundlagen auf. Die Kritik entzündet sich an den Handelsbeziehungen zu den nicht industrialisierten Länder des Südens und der Rolle des Schweizer Finanzplatzes, der Emanzipation der Frauen, der Umweltgefährdung durch die Industrie und der Gewinnung von Atomstrom. «Verantwortung» wird neu verstanden und eine international-globale ethische Orientierung setzt sich durch. Daraus entstehen die neuen sozialen Bewegungen und ihre Vereine. Die Gründungen der neuen Frauenbewegung zählen ebenso dazu wie der Verkehrsclub der Schweiz oder die «Erklärung von Bern» als wichtigste Organisation der «Dritte-Welt-Bewegung». Letzte hat sich vor wenigen Jahren in «Public Eye» umbenannt und bringt damit die Intention der rebellischen Gründerjahre auf den Punkt: ein erneutes aufklärerisches Einfordern einer kritischen zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Staat und Gesellschaft und eine neue Agenda der Fragen, die – in einer zunehmend globalisierten Welt – von öffentlichem Interesse sind. Das ist heute genau so aktuell wie vor sechzig Jahren.
Die bürgerliche Vereinswelt gerät nach 1960 in eine lang anhaltende Krise. Der gesellschaftliche Umbruch stellt ihren Wertehorizont grundlegend infrage. Die einst emanzipatorische Komponente einer bürgerlichen Moral ist längst Geschichte. «Bürgerlich» bedeutet mittlerweile reaktionär, verstaubt und verklemmt. Die unterschwellig erziehende, bürgerliche Werte und Lebensformen vermittelnden Funktionen verlieren an gesellschaftlichem Rückhalt. Eine gewaltige Umstrukturierung setzt ein. Viele traditionelle Vereine haben Nachwuchsprobleme und leiden an Überalterung. Andere begegnen der Forderung oder der schieren Notwendigkeit, Frauen gleichberechtigt aufzunehmen, so auch die Schiessvereine. Nochmals andere richten ihre Angebote und Strukturen neu aus. So ändern Chöre etwa ihr Repertoire oder erarbeiten projektmässige Aufführungen.
Die Veränderungen der bürgerlichen Vereine werden generell als Vereinssterben wahrgenommen. Zunehmende Kommerzialisierung in Sport und Kultur oder auch die Scheu, im Vorstand Verantwortung zu übernehmen oder sich zu binden, werden als Gründe genannt. Was wir seit 1960 beobachten, ist indessen viel eher der Verlust der historischen und identitätsstiftenden Rolle bürgerlicher Vereine als Vermittlerinnen von Moral – und generell den Abschied vom Verein als Instrument der Volkserziehung und der soziokulturellen Strukturierung.
Der Verein als Instrument der Selbstorganisation scheint dagegen auch in der Gegenwart äusserst attraktiv. Die Grundidee eines freien Zusammenschlusses macht ihn flexibel und anpassungsfähig. Die 1960 einsetzende, grossräumige Veränderungen und Erneuerungen der Vereinslandschaft reichen – genauso wie die gesellschaftliche Verständigung über verbindliche Geschlechtsidentitäten, die ebenfalls in den 1960er-Jahren zu erodieren beginnen – bis in die Gegenwart.
Beatrice Schumacher (*1963) ist freischaffende Historikerin und lebt in Basel. Sie hat u.a. zur Geschichte gemeinnützigen Denkens und Handelns sowie zu Vereinen in der Schweiz publiziert. Zuletzt erschienen: „Uetikon und seine Chemie. Eine Beziehungsgeschichte“, in der die Rolle des lokalen Männerchor besondere Beachtung findet (Hier und Jetzt 2022). beaschumacher.ch