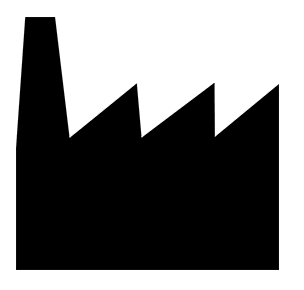Begonnen hat alles mit der Frage, welchen Beitrag Literatur zu einer offenen, freigeistigen Gesellschaft leisten kann. Insbesondere in Zeiten, wo viele Gesellschaften in der Auseinandersetzung mit Migrationsbewegungen ihre garstigen Scheuklappen hochziehen und zähnefletschend so etwas wie die «eigene Identität» oder das «Eigene» bewahren wollen, indem sie alles, was ihnen unbekannt, fremd, anders erscheint, ängstlich und hasserfüllt von sich stossen.
Auch in Südtirol haben wir 2015 vermehrt bemerken müssen, wie xenophobe Marktschreier durch die Gassen ziehen und sich viele einmal mehr nach eingemauerten Identitäten sehnen. Obwohl gerade diese Provinz mit ihren rund 500.000 Einwohnerinnen seit langer Zeit von Austausch und Zusammenleben mehrerer Kulturen und Sprachen geprägt ist. Und genau damit auch touristisch wirbt: «Mediterrane Lebensfreude und deutsche Pünktlichkeit», «Spaghetti und Knödel», «Beim urigen Tiroler eine Hauswurst kaufen und anschliessend um die Ecke auf Italienisch einen Cappuccino bestellen» – auf diese Weise wird Südtirol nach aussen hin inszeniert. Das Problem dabei: Wenn kulturelle Vielfalt hoch-gehalten wird, dann oft eben nur als Schmuck und Schminke. Was sich nicht verwerten lässt, wird vernachlässigt. Während das Zusammensein von Italienisch und Deutsch in Südtirol also viel Raum bekommt, werden Südtirolerinnen, die Ladinisch sprechen, oft erst gehört, wenn sie auf sich aufmerksam machen. Und alle anderen, etwa jene mit arabischen, albanischen, bonischen, iranischen, etc. Hintergründen, bekommen so oder so nur marginalst Sichtbarkeit, sei es auf gesellschaftlicher oder kultureller Ebene.
Gerade deshalb sollte «Lyrischer Wille» anfangs kein transnationales Übersetzungsprojekt sein, sondern sich innerhalb des Gebiets Südtirol entfalten: Wir engagierten ausschliesslich Autorinnen aus Südtirol dafür, um sichtbar zu machen, wie gross und bereichernd die Vielfalt in einem so kleinen geographischen Kontext sein kann – wenn man sie eben sehen will. Die Suche nach Autorinnen, die nicht oder nicht nur auf Deutsch schreiben, war allerdings alles andere als leicht. Wir realisierten, wie wenig Kontakt zwischen Autorinnen verschiedener Sprachen selbst in der überschaubaren Südtiroler Literaturszene besteht, und nicht zuletzt, wie wenig auch wir Initiatoren, Arno Dejaco und ich, uns mit Literaturen anderer Sprachen beschäftigt hatten. In der Hoffnung, dass sich dies langfristig ändert – auch indem Lyrischer Wille einen Beitrag dazu leistet – begannen wir zu recherchieren und konnten nach einiger Zeit des Suchens und vielen freudigen Begegnungen 55 Autorinnen für dieses Projekt begeistern: Schriftstellerinnen, die auf Italienisch, Ladinisch, Albanisch, Bosnisch, Farsi, Sorani, Arabisch, Bulgarisch, Deutsch, usw. schreiben.
«Lyrischer Wille» wollte und will diese Diversität mit literarischen Mitteln zelebrieren, Perspektiven eröffnen und Möglichkeitsräume bieten, um Barrieren zu überwinden und sich in einem Miteinander auf Augenhöhe zu begegnen. Literarisch erahnen, wie ein gesellschaftliches Zusammenleben ohne Scheu vor Unbekanntem aussehen könnte. Zeigen, dass es auf literarischer Ebene einen Willen gibt: Einen lyrischen Willen, der im Gegenzug zu dem weit verbreiteten gesellschaftlichen Un-Willen nicht vor Andersartigem zurückschreckt, sondern neugierig und feinfühlig damit umgeht.
Das Konzept ist recht simpel: Autorinnen bekommen Gedichte zugesandt, die in für sie «nicht-verständlichen» Sprachen geschrieben sind und werden so auf literarischer Ebene mit dem «Unbekannten» konfrontiert. Dazu kriegen sie die Anweisung, dieses Gedicht in die eigene Sprache zu bringen, wie auch immer diese geartet sein mag und auf welche Art und Weise das gemacht werden könnte. Das daraus entstehende neue Gedicht kommt zu uns zurück, und wird wiederum weitergeschickt, sodass sich das Ausgangsgedicht bald in ein vielgestaltiges und vielsprachiges Kettengedicht verwandelt. Die Reihung der Autorinnen, welche von uns von Mal zu Mal intuitiv bestimmt wird, ist neben dem Auswählen der Autorinnen der einzige kuratorische Eingriff.
Ein grosses Anliegen war und ist uns dabei auch die Übersetzung von einer Sprache in dieselbe. Weil es eben nie genau dieselbe Sprache ist und dies in der Literatur mit all den eigenständigen literarischen Stimmen ganz besonders offen-sichtlich wird. Uns war bald klar: Während zwischen zwei verschiedenen Sprachen nur ein vermeintliches Unverständnis herrscht, ist das Verständnis zwischen zwei gleichen Sprachen nur ein sehr relatives. Jede Sprache strahlt wie jede Existenz immer als singuläre Einzigartigkeit. Und immer geht‘s ums Übersetzen, ums Über-Setzen.
Welche waghalsigen Methoden dabei praktiziert werden können, zeigt sich auf verblüffende Art und Weise im Buch, das aus den Übersetzungen der 55 Autorinnen entstand. Texte wurden von einer Lautlichkeit in die andere gebracht, wurden visuell übersetzt, wurden zu Liedern; Hilfsmittel wie Google-Translate wurden dazwischengeschaltet; die Autorinnen trafen sich und tauschten sich aus, wie beispielsweise Teresa Palfrader und Gentiana Minga. Die ladinische Autorin unterhielt sich auf Italienisch mit der albanischen Autorin, um deren albanisches Gedicht ins Ladinische zu bringen.
Anders als im Buch offenbaren sich die Bewegungen der Übersetzungsprozesse, wenn die Texte hörbar gemacht werden. Die Autorinnen haben dafür eine Übersetzungskette eingelesen, die dabei entstandene Audio-Datei wurde auf Festivals präsentiert und lässt sich auch auf unserer Website anhören. Im Hören, wie die Sprachen zu- und ineinander finden, und wie die Autorinnen literarisch miteinander umgehen, wird – so finden wir – nochmal ganz anders eine gesellschaftliche Ebene tangiert.
Nachdem das Buchprojekt mit den 55 Autorinnen, 15 Sprachen und 7 Übersetzungsketten 2018 abgeschlossen war, haben wir uns entschieden, die Idee des lyrischen Willens fortzuführen und in anderen Kontexten zu realisieren. Im Rahmen einer Lesereihe sind wir seither in verschiedenen Städten unterwegs, engagieren lokale Autorinnen verschie-dener Sprachen, die zusammen ein Kettengedicht erstellen, um dies dann in Kombination mit eigenen Texten bei einer Lesung zu präsentieren. Auch hier staunen wir jedes Mal über die Feinfühligkeiten und die verantwortungsbewussten Wagnisse der Autor*innen in Begegnung mit «unverständlichen» Texten.Dabei wurde immer wieder auch übers Verstehen diskutiert und über die Frage, was das eigentlich bedeuten soll. Für uns zeigt sich beim Durchblättern des Buches und nach den Erfahrungen mit der Lesereihe, dass eben alles verstanden werden kann, wenn es einen Willen dafür gibt. «Verstehen» ist ein offenes Feld. Alles, was im ersten Moment fremd und
unverständlich erscheint, wird faszinierend, wenn man sich darauf einlässt, ihm respektvoll, empathisch und umsichtig begegnet.
Vielleicht ist ein Projekt wie dieses imstande, Impulse auszusenden, die eine Gesellschaft ermutigen, Andersartigkeit in erster Linie als Bereicherung zu verstehen und sich den Potentialen von Mehrsprachigkeit und Diversität einmal mehr bewusst zu werden. Und letztendlich befragt es auch die Literatur selbst, inwiefern sie nämlich geartet sein könnte, wenn sie sich in einem Feld bewegt, das nicht von Sprachgrenzen durchzogen ist.
Matthias Vieider ist Autor und Musiker aus Südtirol. Seit 2016 kuratiert er zusammen mit Arno Dejaco das Übersetzungsprojekt «Lyrischer Wille – Poesie einer multilingualen Gesellschaft». 2018 erschien im folio Verlag das dazugehörige Buch, für das sich 55 Autor*innen aus Südtirol in insgesamt 15 Sprachen übersetzten. Ein Übersetzungszyklus daraus wurde als Audioinstallation produziert. Seit 2018 wird die Idee des Lyrischen Willen im Rahmen einer Lesereihe fortgeführt. www.lyrischerwille.com